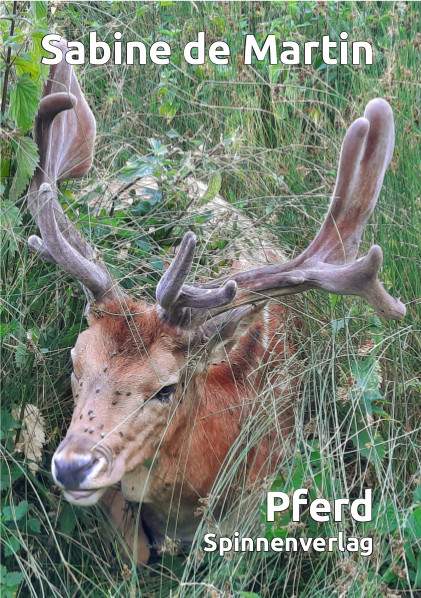
Eine einfühlsame Begegnung, voller Sehnsucht und Ambitionen! Ich könnte mich in das Pferd sofort verlieben — und in die Protagonistin auch! Aus der Rezension von Laura Stute, Pferdepsychologin und beliebte Moderatorin auf hypothetischen Kongressen
Leseprobe:
Auf der Straße kommt mir ein Pferd entgegen. Allein. Ohne Sattel. Ein nacktes Pferd. Es bleibt stehen und hält seine Schnauze an den Flieder, schnuppert an den lila Blüten, schnaubt und geht weiter. Es ist April und warm, ein ruhiger Nachmittag, niemand ist auf der Straße, nur die Hufe klappern auf dem Asphalt, der Pferdeschwanz schlägt, und die Fliegen, die mal reiten wollten, werden links und rechts verjagt und taumeln in der Luft herum.
Ich denke an die Frau meines Lebens, und dass heute der richtige Tag wäre, um sie kennen zu lernen. So ein sonniger Frühlingstag, an dem die Bienen goldene Hosen aus Blütenstaub tragen und die Maulwürfe nach dem nächtlichen Regen in der warmen Erde gut voran kommen. Das Pferd ist vielleicht ein Zeichen. So ein Glückspferd sollte ich nicht aus den Augen lassen. Ich wende mein Fahrrad und folge ihm.
